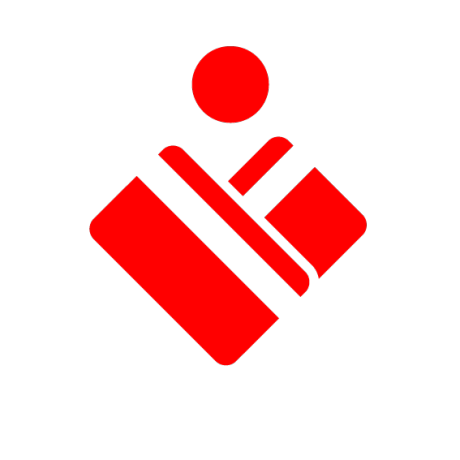Barrierefreiheit stellt sicher, dass alle Menschen ihr Leben weitestgehend autonom gestalten können – unabhängig davon, ob motorische, sensorische oder kognitive Einschränkungen vorliegen. Gerade angesichts des demographischen Wandels wird das Thema immer wichtiger. Was das für den stationären Handel bedeutet.
Text: Sarah Lohmann
„Barrierefreiheit ist ein Menschrecht!“ – so heißt es in einem Artikel des Sozialverbands VdK Deutschland. Sie sei „die Grundlage dafür, dass alle Menschen gleichberechtigt am Leben teilhaben können.“ Auch beim Einkauf. Das ist nicht nur wichtig für Menschen mit Einschränkungen ganz gleich welcher Art, sondern auch für Ältere, Kinder, Eltern mit Kinderwagen sowie Personen mit zeitweise eingeschränkter Mobilität.
Alles geregelt – mit vielen Ausnahmen
Die Definition von barrierefreiem Einkaufen in Deutschland ist Ländersache und in der Verkaufsstättenverordnung (VkVO) fixiert. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gilt sie für Geschäfte mit mehr als 2000 Quadratmetern und regelt Mindeststandards für Konstruktion, Sicherheit und Brandschutz, schreibt das Onlineportal Ladenbau.de.
Die Bauordnung für NRW sieht barrierefreies Bauen für öffentlich zugänglich Anlagen wie Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten sowie Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen vor und hat dafür Normen und Empfehlungen erlassen. Dabei gibt es Ausnahmen, wenn „wegen schwieriger Geländeverhältnisse oder wegen ungünstiger vorhandener Bebauung Auflagen nur mit einem unverhältnismäßigen Mehraufwand erfüllt werden können.“ Viele Einzelhändler müssen daher nicht aktiv werden.

Tatsache ist, dass es nicht nur viele Ausnahmen gilt, sondern auch so gut wie keine Zahlen dazu, wie es um die Barrierefreiheit im Handel steht. Die neueste Untersuchung stammt aus dem Jahr 2016 und ist vom Informationsdient „Marktjagd“. Dieser hatte rund 280.000 deutsche Einzelhandelsgeschäfte in Hinblick auf ihre Barrierefreiheit untersucht. Das Ergebnis: Lediglich 10 Prozent waren barrierefrei.
Was die DIN-Norm fordert
Wer sich positiv von der Konkurrenz mit einem barrierefreien Laden absetzen will, sollte sich die DIN 18040 genauer ansehen. Das ist die Grundnorm für barrierefreies Bauen und Planen, die sich auch auf Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstätten bezieht. Zu den baulichen Maßnahmen sowie zu den Grundlagen der Gestaltung für barrierefreie Verkaufsstätten zählen unter anderem:
- ein barrierefreier Zugang
- ausreichende Bewegungsflächen
- ausreichend große Regalabstände von mindestens 1,50 Meter
- Eine Anpassung der WCs – unter anderem ein WC für behinderte Menschen – und Umkleidebereiche (hier sind 1,50 mal 1,50 Meter Bewegungsfläche gefordert)
- das Schaffen von barrierefreien Stellplätzen
- gut lesbare, kontrastreiche Preisschilder
- ein kontrastreicher Eingang, insbesondere bei Glasscheiben
- mindestens eine Kasse mit abgesenktem Thekenbereich
- mindestens eine Kasse mit technischer Hörhilfe.
Barrierefreie Parkplätze von 3,50 mal 5 Meter, die ausreichend Platz zum Rangieren bieten und in der Nähe des Eingangs angeordnet sind, gehören heute zum Standard vor größeren Geschäften und Einkaufszentren. Schlechter sieht es schon bei stufenlosen Zugängen und Automatiktüren aus. Was den Bau von Rampen zu erhöht liegenden Eingängen betrifft, müssen laut der DIN-Norm gewisse Regeln eingehalten werden: Die Rampe darf nicht zu steil und nicht zu lang sein, es muss beidseitig Handläufe geben und Radabweiser. Alternativ besteht die Möglichkeit eines Lifts, der einem Rollstuhl oder Kinderwagen Platz bietet.
Weiter geht es im Eingangsbereich. Hier helfen schon einfache Maßnahmen: Schmutzschutzmatten am Eingang dürfen nicht verrutschen und müssen für die Rollen von Rollstühlen und Kinderwägen geeignet sind. Ebenso sollte gerade im Eingang mit stärkeren Kontrasten gearbeitet werden, besonders bei Glasflächen. Und auch eine ausreichende Beleuchtung ist sinnvoll. Bei Treppen sind eine Markierung am Trittstufenende und der beidseitige Handlauf zu empfehlen.
Ausreichend Platz im Ladengeschäft
Weiterer Bestandteil der inklusiven Ladengestaltung sind breite Gänge und luftige Kassenzonen, in denen Rollstuhlfahrerfahrer problemlos rangieren können. Laufzonen sollen in hochfrequentierten Geschäften zwischen 1,80 und 2,20 Meter breit sein, bei weniger hohen Besucherzahlen genügen 1,50 Meter. Dabei sollten Hindernisse natürlich aus dem Weg geräumt werden – ungünstig platzierte Papierkörbe zum Beispiel. Für Durchgänge sind 90 Zentimeter festgeschrieben.
Hilfreich sind auch Sitzmöglichkeiten – diese können nicht nur für Menschen mit Einschränkungen eine enorme Entlastung darstellen. Vor Aufzügen sind Warteflächen von 1,50 mal 1,50 Meter vorgesehen, die Mindestfahrkorbfläche beträgt 1,40 mal 1,10 Meter. Alle Maße sind genormt und in der DIN 18040-1 geregelt.

Die Anforderungen an barrierefreie Sanitärräume werden in der DIN 18040, Teil 2, definiert. Besonders wichtig hierbei: Ein barrierefreier Zugang und ausreichend Platz auf einer Bewegungsfläche von 1,50 mal 1,50 Metern. Günstig in der Anschaffung und nützlich sind Stütz- und Handhaltebügel sowie tief angebrachte Lichtschalter und geneigte Spiegel. Temperaturbegrenzte Einhebelmischarmaturen mit langen Hebeln kommen ebenfalls vielen Menschen zugute.
Sicherheit durch Orientierung
Sich in einem großen Geschäft zurecht zu finden, kann herausfordernd sein. Orientierungshilfen schaffen Erleichterung – durch ein farbiges und haptisch hervorgehobenes Bodenleitsystem zum Beispiel, dass sehbehinderte und blinde Menschen bei der Navigation durch den Store unterstützt.
Unerlässlich ist natürlich, Gefahrenstellen zu kennzeichnen. Wenn es brennt, müssen laut DIN 18040 Türen, Scheiben, Treppen und Co. sofort erkennbar sein – und zwar auf Basis des Zwei-Sinne-Prinzips. Optische Signale müssen um akustische oder taktile ergänzt sind, etwa durch Blitzleuchten oder Vibrationsalarme. Auch eine deutliche Kennzeichnung des Kassenbereichs ist hilfreich – nicht nur für Menschen mit Einschränkung. Bei der Implementierung eines solchen ganzheitlichen Leitsystems muss darauf geachtet werden, dass alle Informationen in leichter Sprache verfasst sind.
Reicht das?
Laut VdK-Präsidentin Verena Bentele kann darüberhinausgehend noch sehr viel für Menschen mit Einschränkungen getan werden – sie denkt dabei unter anderem an niedrigere Regale für kleinwüchsige Menschen und an Preisschilder, die von blinden Menschen beispielsweise mithilfe des Smartphones gelesen werden können. Außerdem könne das Personal helfen – wenn Mitarbeiter die Gebärdensprache beherrschen, können sie mit gehörlosen Kunden kommunizieren. Einpackhilfen könnten dabei unterstützen, die Einkäufe von körperlich eingeschränkten Personen sicher zu verstauen – eine Servicedienstleistung, mit der gerade kleine Geschäfte nicht umsetzbare bauliche Veränderungen zumindest teils kompensieren können.
Weitere Besonderheiten sieht die Expertin bei Menschen mit autistischer Störung, die schnell überreizt sind – beispielsweise durch Musik, grelles Licht, Scanner-Piepen oder Durchsagen. Hier bewiesen die Filialen von Rewe und Edeka im nordrheinwestfälischen Bergisch Gladbach ihre Vorbildfunktion für den Einzelhandel bereits im Jahr 2022 – sie führten die „Stille Stunde ein“, eine Idee, die beispielsweise in der Schweiz schon länger umgesetzt wird. Das Konzept: Während eines begrenzten Zeitraums werden geräusch- und allgemein reizärmere Bedingungen geschaffen, in denen sich autistische Menschen wohler fühlen. Und auch für andere Kunden sollen die reduzierten Außenreize eine Entlastung darstellen.
Das heißt für Sie
Barrierefreies Einkaufen schafft eine angenehmere Umgebung und ist wichtiger Bestandteil einer inklusiven Gesellschaft. Es ist aber auch ein Prozess des Lernens und Differenzierens, denn nicht jedes Geschäft ist in der Lage, alle Anforderungen umzusetzen oder entsprechend geschultes Personal einzustellen – dennoch lohnt es sich, an den Stellschrauben zu drehen, an denen gedreht werden kann. Viele Bausteine lassen sich leicht und kostengünstig integrieren und der Einsatz kann am Ende dazu beitragen, neue Kundengruppen zu gewinnen.
Fotos: Adobe Stock